| home | Radkauf | Technik | Licht | Radeln | Bremsunfall | Info-Links | Tour-Links | WB d-efi |
|---|
|
|
 |
|
|
|
RadtippsEin Ratgeber fürs Fahrrad /k |
Immer wieder werde ich gefragt, wie man sich ein passendes Rad aussucht.
Normalerweise gehen Sie zum Radhändler und der sollte Ihnen ein gutes und nicht zu teures Rad empfehlen. Die meisten Händler wissen recht gut Bescheid und können Sie vor einem Fehlkauf bewahren.
Doch mancher Händler hat im Frühjahrsgeschäft zu wenig Zeit oder er hat einige Ladenhüter herumstehen; das kann ihn durchaus in Konflikte bringen. Deshalb sollten Sie sich auf den Radkauf vorbereiten und wissen, was Sie wollen/ brauchen und auch was Sie nicht wollen.
![]()
Diese Ratschläge liefern Ihnen ein Grundgerüst an Wissen, das Ihnen hilft, ein passendes Rad finden.
Die heute üblichen Räder teilt man in folgende Gruppen ein:
|
Cityrad, Stadtrad, Einkaufsrad, Ausflugsrad. | 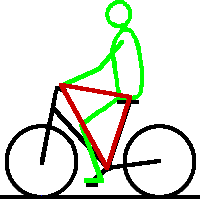 Bild k21 |
|
|
Hollandrad.
|
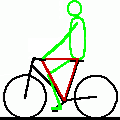 |
|
|
Trekkingrad, Tourenrad, All-Terrain-Bike (ATB).
Reiserad.
Crossrad.
|
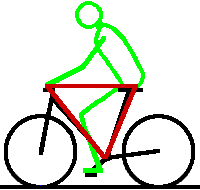 Bild k22 |
|
|
Mountainbike (MTB).
|
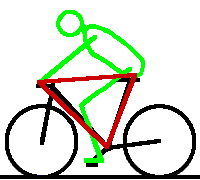 Bild k23 |
|
|
Rennrad.
Fitnessrad.
Liegerad.
|
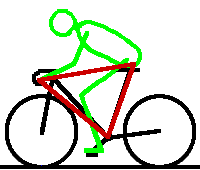 Bild k24 |
Elektrorad / Pedelec.
Dieses Rad ist seit 2013 große Mode geworden. Es ist ähnlich dem Trekkingrad für Touren auf Straßen und Feldwegen ausgelegt.
![]()
Elektrorad ist der allgemeine Begriff. Es hat keine Beschränkung in Leistung und Geschwindigkeit. Deshalb erfordert es - wie ein Moped - Helm, Versicherungskennzeichen und Führerschein.
Pedelec, auch Pedelec25, ist ein Elektorad mit bestimmten Einschränkungen in Leistung (max. 250W) und Geschwindigkeit (max. 25 km/h mit Motorunterstützung). Man braucht weder Helm noch Versicherungskennzeichen und Führerschein.
![]()
Die Benutzer kaufen es sich meist aus folgenden Gründen:
-- Pendler müssen sich bei der Fahrt zur Arbeit weniger anstrengen, weshalb sie dann nicht so verschwitzt ankommen.
-- Wenn man wenig im Training ist und Berganstiege scheut oder eine vorzeitige Ermüdung auf längeren Ausflügen fürchtet.
-- Auch gut trainierte Ältere mögen es nicht, wenn die kräftigen Jungen ihnen am Berg davon fahren und sie dann hinterher keuchen müssen.
-- Einen Einzigen habe ich gefunden, der es nützt um längere Touren zu bewältigen.
![]()
Noch 2013 war die Qualität der Pedelecs zweifelhaft. So waren bei der Zeitschrift
==> Test
laut Heft 6/13 "E-Bikes mit Risiko" (hier gemeint: Pedelecs) wegen Rahmen- und Lenkerbruchs, Bremsversagen und Funkstörung 9 von 16 Rädern durchgefallen - Testurteil "Mangelhaft". Die Hersteller wollten bei dem zwei- bis vierfachen Umsatz je Verkauf gegenüber einem Rad mitmachen. Sie hatten nicht bedacht, dass ein Elektrorad die doppelte Leistung (Fahrer plus Motor) aushalten muss.
Beim Test 08/14 "Die besten E-Bikes" (Pedelecs) erreichten wegen Anrissen zwar 3 von 10 Rädern nur ein "Ausreichend", aber der Rest war in Ordnung. Meiner Meinung nach wird es noch 2 - 3 Jahre dauern, bis auch Pedelecs den Qualitätsstandard der guten Fahrräder erreichen. Auch bei den Steuerungen gibt es noch Unbeholfenheiten.
![]()
Das Gewicht liegt bei 20 - 30 kg; für Mehrtagestouren müssen Sie noch das Ladegerät addieren. Damit kann es nicht mehr jede die Bahnhofstreppe hinauftragen. Der Akku braucht besondere Sorgfalt, da er bei Überladen oder einem Unfall mit Beschädigung explodieren oder in Brand geraten kann.
![]()
Eine besondere Zukunft sehe ich für Pedelecs bei Lastenrädern und bei Dreirädern, insbes. Liege-Dreirädern (für Leute mit Handicap). Ich persönlich werde so lange es geht, lieber mit einem normalen Rad auf Touren gehen.
Für den Alltagsradler eignen sich also City-, Trekking und Reiseräder. Deren Auswahl wird im Folgenden weiter beschrieben.
Literatur:
![]()
Tipps zur Wahl der Art des Fahrrads gibt es im "Utopia Radratgeber"
==> Meine Sitzposition ...
![]()
Eine ausführliche Darstellung zur Wahl des Fahrrads und seiner Komponenten gibt es bei:
-- Allgemeinener Deutscher Fahrrad-Club ADFC, Fachausschuss Technik unter
==> Tipps für den Fahrradkauf
-- und im
==> RadRatgeber
der Fa. Utopia.

Ergonomie bedeutet die Anpassung einer Maschine an den Menschen, an den Benutzer.
![]()
Leider gibt es da ein Problem: Der Mensch gewöhnt sich schnell an eine neue Körperhaltung und er glaubt dann, diese sei die beste. Damit ist er für Korrekturen nicht mehr ohne Weiteres zugänglich. Da man am Anfang eine unbequeme Haltung schneller erkennt, sollten Sie Fehler immer sofort korrigieren!
Die ergonomische Anpassung des Rads an den Fahrer bestimmen in erster Linie die Rahmenmaße sowie die drei Kontaktpunkte von Fahrer und Rad: Sattel, Pedale und Lenker.
Ziel ist immer, dass der Rücken seine natürliche S-Form behält sowie, dass Arme und Oberkörper einen rechten Winkel bilden.
Literatur: Bei "Allgemeinener Deutscher Fahrrad-Club ADFC", Fachausschuss Technik gibt es eine ausführliche, gut gegliederte Ausarbeitung zum Thema
==> Richtig sitzen.
Eine etwas neuere Ausgabe finden Sie hier als Anlage
==> Ergonomie des Fahrradfahrens
im pdf-Format.
Copyright des hier vorliegenden Skripts bei Juliane Neuß! Nachdruck, auch auszugsweise, und Verwendung von Grafiken sowie fotomechanische Wiedergabe nur mit schriftlicher Genehmigung der Autorin Juliane Neuß, Haferberg 2, 21509 Glinde.
Die Autorin hat zu diesem Thema ein Buch herausgebracht,das zu empfehlen ist: "Richtig sitzen - locker Radfahren" ISBN 978-3-7688-5322-4.
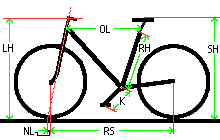 Bild k31 |
|
k3.1.1. Basismaße
Innenbeinlänge. Sie ist das Ausgangsmaß für die Bestimmung der Rahmenhöhe. |
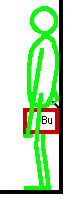 Bild k311 |
Die folgenden Angaben dienen nur zur Ergänzung für Interessierte. Alle Rahmenmaße werden vom jeweiligen Hersteller passend, aber unterschiedlich, zur Rahmenhöhe festgelegt; m.a.W., Sie können sie nicht verändern. Deshalb unterscheiden sich Ergonomie und Fahrverhalten der Räder verschiedener Hersteller. Für Sie bedeutet das: Sie müssen ein neues Rad ausgiebig ausprobieren!
Oberrohrlänge. Sie muss zur Oberkörperlänge passen, da sie Fahrverhalten und Ermüdungsfreiheit des Sitzens bestimmt. Falls das Rad zu kurz oder zu lang ist, kann sie durch den Lenkervorbau ausgeglichen werden.
Die richtige Oberrohrlänge liegt vor, wenn Arme und Oberkörper einen rechten Winkel bilden (für Mathematiker: Oberrohrlg = Wurzel (Armlg^2 + Körperlg^2).
![]()
Warnung: Die Händler führen meist mittelgroße Räder im Laden, da sie jeder fahren kann, außer kleinen Menschen. Der Kunde will das Rad möglichst gleich mitnehmen und so fährt ein Großgewachsener dann jahrelang mit einem zu kurzen Rad.
Bestellen Sie das Rad mit der richtigen Rahmenhöhe! Dann ist auch die Länge des Rads einigermaßen richtig. Nachteil ist, dass Sie die Lieferzeit abwarten müssen.
Radstand. Das ist der Abstand der beiden Achsen von Vorder- und Hinterrad. Je länger er ist, umso fahrstabiler ist das Rad.
Bei Cityrädern liegt er meist unter 110 cm, bei Reiserädern darüber.
Nachlauf. Das ist der Abstand zwischen Aufsetzpunkt des Vorderrads am Boden und der verlängerten Steuer-Mittelachse (Gabelrohr-Mitte). Je länger er ist, umso fahrstabiler ist das Rad; dafür aber schwerer freihändig zu fahren.
Bei Rennrädern beträgt er ca. 5 cm, bei Reiserädern ca. 8 cm, er sollte 11 cm nicht übersteigen, da sich sonst das Rad zu steif lenkt.
Kurbellänge. Sie beträgt meist 170 - 175 mm. Sie passt für Menschen von etwa 160 - 190 cm Körperhöhe. Kleinere Menschen sollten eine kürzere Kurbel einbauen lassen, z.B. 165 mm, sonst werden die Knie am oberen Totpunkt zu stark angewinkelt.

Der Sattel trägt den größten Teil des Fahrergewichts. Damit ist auch das Gesäß dem höchsten Druck ausgesetzt. Wenn der Sattel nicht zum Gesäß passt, dann sind bald Taubheitsgefühle oder Schmerzen zu spüren.
Wichtig ist, dass die Sitzhöcker (können Sie am Gesäß leicht ertasten) das Hauptgewicht tragen. Das wird nur mit einem Sattel gelingen, der beim Druck mit dem Daumen auf die breite Fläche nicht allzu viel nachgibt; Gel-Sättel sind also nur dann geeignet, wenn die Gelschicht sehr dünn ist.
Auch Training wirkt sich bei der Sitzbelastung aus. Eine Radreise-Führerin erzählte mir, dass bei Touren im Mai häufig über Schmerzen gejammert wird, während man im August nichts davon hört.
Grundformen:
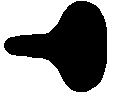 Bild k3211 |
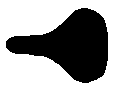 Bild k3212 |
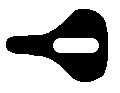 Bild k3213 |
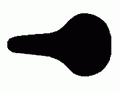 Bild k3214 |
| City | Reise, Trekking | Reise, mit Loch | Rennrad |
City: Der breite Sattel (ca. 18 cm) verteilt das Gewicht auf eine große Fläche. Deshalb fühlt er sich die erste Stunde sehr angenehm an. Da man auf dem Cityrad aufrecht sitzt und diese Sättel meist sehr weich sind, drückt er dann auf alle Gesäßteile mit dem gleichen Druck (insbesondere auf den Damm), ... und es ertauben mit der Zeit Geschlechtsteile, Beine und sogar die Zehen.
![]()
Reise, Trekking: Für längere Radtouren ist dieser mittelbreite Sattel (Breite ca. 14-17 cm) meist die beste Lösung.
![]()
Reise, mit Loch: Der Damm befindet sich über der Aussparung; somit bekommt er wenig Druck.
![]()
Rennrad: Der schmale Sattel ist meist sehr hart. Die Fahrer sitzen auch auf den Gesäßmuskeln und der Sattel drückt nicht mehr so stark auf den Damm. Außerdem sind Rennradler oft schnell unterwegs, d.h. die Beine übernehmen mit der Tretkraft einen großen Anteil des Gewichts; das Gesäß wird entlastet.
Diese allgemeinen Hinweise zeigen, dass der Sattel ausgesucht werden muss, d.h. fahren Sie mindestens zwei Tage damit herum (üblicherweise gesteht der Händler eine Woche zu)! Ein Händler, der Ihnen diese Erprobung nicht erlauben will, ist auch sonst mit Vorsicht zu genießen.
Literatur:
1. Weitere Hinweise finden Sie unter
==> Sattelkunde
im Internet oder als Anlage
==> Sattelkunde
im pdf-Format.
(Copyright des Skripts bei "pressedienst-fahrrad Gunnar Fehlau"! Nachdruck erlaubt. Beleg erwünscht an
Gunnar Fehlau.)
2. Artikel zum Sattel "Problemlöser" in
==> Trekkingbike
2/2011 Seiten 88 - 95, in dem von den Grundsätzen bis zum Gesundheitssattel viele Einzelpunkte angesprochen werden.
3. Artikel "Sattel im Fokus" in
==> aktiv Radfahren
6/2011 Seiten 66 - 79, in dem die Eigenschaften des Sattels erläutert und Tests gezeigt werden. (Sehr informativ).
Einstellen des Sattels:
![]()
| Sattelneigung: Die Oberfläche des Sattels soll waagrecht sein (es gibt sogar Leute, die das mit der Wasserwaage kontrollieren). Falls man doch eine Neigung einstellt (meist - wie im Bild rechts - nach vorne unten, z.B. bei Taubheitsgefühlen), darf diese nur minimal sein. |
 Bild k3215 |
| Sattelhöhe: Drehen Sie ein Pedal ganz nach unten. Setzen Sie sich auf das Rad und halten Sie sich an einer Mauer oder einer Stange aufrecht. Die richtige Höhe ist eingestellt, wenn Sie bei ganz gestrecktem Bein mit dem Mittelfuß (d.h. vor dem Schuhabsatz) sauber auf dem Pedal stehen. Achten Sie darauf, dass Sie das Becken dabei nicht auf die Seite kippen! Da Sie beim Fahren den Vorderfuß (Fußballen) benützen, bleibt auch am unteren Pedalpunkt das Knie immer noch leicht angewinkelt. Und so soll es sein! Absteigen: Zum Absteigen bremsen Sie zuerst bis fast zum Stillstand, stellen sich dann auf das untere Pedal, gehen aus dem Sattel, bremsen mit der Handbremse ganz ab und setzen dann den anderen Fuß auf den Boden. (Das zu üben haben insbesondere Frauen nötig, die in der Kindheit nicht abstiegen, sondern absprangen und neben dem Rad herliefen bis es stand.) |
 Bild k3216 |
| Knielot: Stellen Sie die Kurbelarme waagrecht. Setzen Sie sich auf das Rad und und stellen Sie die Fußballen auf die Pedale. Nehmen Sie einen Senkel (kann man selbst machen, z.B. mit einem Faden an dem ein Kaffeelöffel hängt) und halten Sie ihn vorne ans Knie. Die Schnur sollte an der Mitte des Pedals vorbeiführen. Wenn nicht, schieben Sie den Sattel vor, bzw. zurück. |  Bild k3217 |
Hinweis: Bei Knieschmerzen stellen Sie den Sattel etwas höher. Einen zu hohen Sattel spürt man sofort, einen zu niedrigen fast nie.
Wenn Sie bei stehendem Rad sitzen bleiben können, so ist der Sattel zu niedrig und Sie riskieren Knieprobleme.

Die mechanische Einstellung der Pedale liegt fest. Mit Ausnahme der ==> Kurbellänge K können Sie nichts verändern, sondern nur die Art des Pedals wählen. Achten Sie auf die vorgeschriebenen gelben Rückstrahler.
 Bild k3221 |
 Bild k3222 |
 Bild k3223 |
 Bild k3224 |
| Gummiauflage für Straßenschuhe |
"Bärentatze" für profilierte Schuhsohle |
Clickpedal, einseitig | Clickpedal, beidseitig. Rückstrahler lassen sich nicht befestigen, deshalb auf der Straße nicht zugelassen. |
Hinweis: Genaueres zu Clickpedalen finden Sie in ==> t3. Click-Pedale
| Ergonomische Handhaltung: Nehmen Sie in jede Faust einen gewöhnlichen (langen) Holzbleistift. Halten Sie dann beide Hände gestreckt vor sich hin, drehen sie waagrecht oder legen sie auf eine Tischplatte. Die beiden Bleistifte zeigen Ihnen genau, wie die Lenkergriffe einzustellen sind: Leicht nach hinten und ein wenig nach unten geneigt. |
 Bild k3230 |
Einfache Lenker
 Bild k3231 |
Bild k3239 |
 Bild k3232 |
Bild k3234 |
 Bild k3233 |
| Bügellenker "Moon" |
Sportlenker | geschwungener Lenker | stark geschwungener "Gesundheits-"Lenker |
gerader Lenker "Besenstiel" |
Bügellenker, "Moon": Seine schlichte Form entspricht weitgehend einer ergonomischen Handhaltung bei nur leicht geneigter Körperhaltung. Er ist meist flach (=nicht gekröpft). Der Winkel nach hinten liegt bei 25°. Beispiel: Tour Alu oder Niro bei
==> Utopia/ Lenker,
Litec Sportlenker bei
==> Rose-Versand/ Lenker.
![]()
Sportlenker: Für Tourenfahrer mit einem
==> Trekking-, bzw. Reiserad
mit einer mittel geneigten Körperhaltung bietet er die richtige ergonomische Handhaltung, da er weniger stark abgewinkelt ist, ca. 14...16°. Er ist flach oder wenig gekröpft (0...3 cm). Beispiele:
==> SQ-Labs 314,
==> Syntace Vector 7075.
![]()
Geschwungener Lenker: Diese Lenker finden manche Radler schöner als einfache Formen. Sie erlauben dem Radler, aufrechter zu sitzen, da die Lenkerhöhe größer ist. Der Lenker ist für
==> Cityräder
geeignet, mit denen man keine langen Touren unternehmen will.
![]()
Stark geschwungener Lenker, "Gesundheitslenker": Diese Lenker weisen mit den Griffen stark nach hinten. Sie erlauben dem Radler aufrecht zu sitzen, da die Griffe näher am Sattel sind. Der Lenker ist eigentlich nur für
==> Hollandräder
geeignet.
![]()
Gerader Lenker, "Besenstiel": Er ist in Mountainbike-Kreisen üblich, um nicht zu sagen in Mode. Er ist meist überbreit und zwingt den Radler zu geknickten Ellbogen. Er erzwingt eine unergonomische Handhaltung. Der Winkel nach hinten liegt meist bei 5...10°. Beispiele: Easton EA50 XC flat bar, Race Face XC Flat Bar, beide
==> Rose-Versand/ Lenker.
Lenker mit mehreren Griffpositionen
 Bild k3234 |
 Bild k3235 |
 Bild k3236 |
 Bild k3238 |
| Multifunktions-, "Brezel"-Lenker |
Bügellenker mit Lenkerhörnchen innen |
gerader Lenker mit Lenkerhörnchen außen |
Rennlenker |
Auf längeren Touren sollte man Hand- und Körperhaltung ab und zu wechseln. Das beugt einer einseitigen Körperhaltung und Schmerzen, insbes. in den Händen, vor.
![]()
Multifunktions-Lenker: Er bietet viele Griffpositionen, hat aber den Nachteil, dass die Bedienelemente (Bremse, Schaltung) am Ende der langen (federnden) Stange liegen und außerdem ziemlich weit innen. Letzteres verringert den Hebelarm und erfordert höhere Kräfte beim Lenken in kritischen Situationen.
![]()
Lenkerhörnchen: Sie verlängern die Lenkstange nicht wie der Multifunktions-Lenker, bieten aber weniger Griffpositionen.
![]()
Rennlenker: Er hat mindestens 3 Griffpositionen. Geübte Radler können damit lange Strecken mit hohem Tempo zurücklegen.
Montage des Lenkers
![]()
Lenkerhöhe:
-- Cityrad: Die Mitte des Griffs soll 5-15 cm über der Sattelhöhe liegen.
-- Beim Hollandrad liegen die Griffe etwa auf Höhe des Sattels.
-- Trekkingrad: Die Mitte des Griffs liegt zwischen 5 cm unter bis 5 cm über dem Sattel.
-- Mountainbike: Die Mitte des Griffs liegt zwischen 10 cm unter bis 5 cm über dem Sattel.
![]()
Lenkerbreite: Der Lenker soll etwa Schulterbreite haben. Für Bügel- und Sportlenker sind 54-62 cm üblich.
![]()
Hinweis: Bei Schmerzen im Handgelenk sollte man den Lenker etwas tiefer(!) stellen und/ oder den Sattel etwas höher.
| Lenker-Vorbau: Durch die Wahl eines kürzeren oder längeren Vorbaus kann man die Sitzlänge verstellen, falls die Oberrohrlänge zu lang (was selten vorkommt) oder zu kurz ist. Beim verstellbaren Vorbau kann auch die Lenkerhöhe verändert werden. |  Bild k3237 verstellbarer Vorbau |
Literatur: Im "tour-magazin" gibt es eine detaillierte Anleitung zum Thema ==> Sitzposition optimal einstellen.

| Herrenrahmen, Diamantrahmen: Er ist als Viereckverbund sehr steif. Das erlaubt einen geringen Materialeinsatz, was in einem geringen Gewicht resultiert. Nachteilig ist er beim Auf- und Absteigen, da das Bein über (Gepäck und) Sattel oder über das Oberrohr geschwungen werden muss. |
 Bild k41 |
| Damenrahmen: Er ist zunächst nicht so steif, wie der Herrenrahmen. Das Auf- und Absteigen geht leicht, was insbesondere in Gefahrensituationen hilfreich ist. Mit wenig Mehraufwand an Material, z.B. einer Versteifungsstrebe (hier blau), kann er trotzdem steifer als ein Herrenrahmen ausgeführt werden. Das Mehrgewicht liegt in der Größenordnung von 1/4 bis zu 1 kg. Praktische Beispiele zeigt ==> Trekkingbike "Damenwahl" Heft: 4-2014 S. 30 - 43. Man darf nie vergessen, dass eine durchdachte Konstruktion eine bessere Lösung ergibt, als das beste Prinzip! Beispiel: Das Utopia Kranich ==> Bild it54 ist zwar selbst schwer, aber es ist auch für eine Last bis 160 kg gebaut. |
 Bild k42  Bild k44 |
| 26-Zoll-Rad: Vorteile sind - wegen des geringeren Durchmessers - eine etwas höhere Steifigkeit (bei gleicher Konstruktion!) sowie eine um 5 cm kürzere Gesamtlänge des Fahrrads. Ein weiterer Vorteil ist seine größere Verbreitung im Ausland (Ersatzteile). Bei Rahmenhöhen unter 50 cm (Körperhöhe unter 160 cm) wird meist ein 26"-Rahmen verwendet. 28-Zoll-Rad: Wegen des größeren Durchmessers läuft es etwas leichter (geringere Walkarbeit) und es fällt nicht so tief in Schlaglöcher. Beispiel: r = Radius (mit Reifen 1,75"); h = Höhe; s = Spaltbreite; e = Eintauchtiefe; Alle Maße in mm. 26": s=200; r1=559/2+47=326,5; h1=310,81; e1=15,7; 28": s=200; r2=622/2+47=358; h2=343,75; e2=14,25; Bei einem 20 cm breiten Spalt ist die Eintauchtiefe beim 26"-Rad ca. 1,5 mm größer als beim 28"-Rad; das entspricht ca. +10%. |
 Bild k43 |
Der Wunsch nach geringem
==> k4.4. Gewicht
führt zu schmalen, leichten Reifen und zu dünnen Schläuchen. Das bringt aber deutliche Nachteile.
Bei gleichem Luftdruck hat ein breiter Reifen einen niedrigeren Rollwiderstand als ein schmaler.
Nicht nur aus diesem Grund sollten Sie einen dicken Reifen, z.B. 47 mm wählen. Der breitere Reifen taucht auf weichem Untergrund (Sand, Schnee,...) nicht so weit ein, ist also besser lenkbar. Außerdem fährt er stabiler auf Schotter (Wald-, Feldwege,...).
Infos zur Wahl eines Reifens finden Sie unter
==> t8. Bereifung/ 3.1 Grundlagen.
Das niedrige Gewicht eines Rads ist zur Zeit ein Marketing-Ereignis. Dazu werden oft Leichtbauteile eingesetzt, z.B. schmale, dünne Reifen. Kotschützer, Gepäckträger und
==> k4.5. Licht
werden weggelassen, damit das Gewicht ca. 2-4 kg niedriger wird.
![]()
Beim Fahren in der Ebene spielt das Gewicht jedoch kaum eine Rolle.
Bergauf ist es schon eher von Bedeutung, aber nicht in dem Maße, wie es die Werbung darstellt. Bergauf zählt nur das Gesamtgewicht von Fahrer, Gepäck und (hier) einem Reiserad, z.B. 80 + 15 + 18 = 113 [kg]. Wäre das Rad um 2 kg leichter, so ergäbe das 111/ 113 kg, also etwa 2% weniger Gewicht. Das spürt man nicht.
Wichtig ist das Gewicht nur beim Tragen des Rads. Zarte Frauen schaffen es ohne Hilfe kaum, ein Rad von 18 kg eine Bahnhofstreppe hinauf zu tragen. Hier ergäben 2 kg schon 11% weniger.
Die Straßen-Verkehrs-Zulassungs-Ordnung StVZO §67 verlangt auf öffentlichen Straßen und Wegen weisse, gelbe und rote Rückstrahler sowie Dynamo- oder Batterielicht. Letzteres ist seit August 2013 erlaubt (die Ausnahmeregelung nur für Rennräder ist damit obsolet).
Die Händler dürfen ein schwereres Rad ohne irgendein Licht und ohne Rückstrahler zwar verkaufen, aber Sie dürften damit eigentlich nicht 'mal nach Hause fahren.
![]()
Alle Licht technischen Einrichtungen müssen ein Prüfzeichen (~~~~K....) tragen und (auch am Tag) funktionieren. Sie müssen am Fahrrad befestigt sein oder mitgeführt werden und sich richtig befestigen lassen, zB. über Sockel oder mit Klemmverbindungen.
![]()
Genauere Infos dazu finden Sie unter
==> l0. Gesetzliche Vorschriften.
Um einem Dieb das Stehlen des Fahrrads möglichst schwer zu machen, muss man es
-- abschließen, d.h. das Rad soll weder gefahren noch geschoben werden können, und
-- anschließen, d.h. das Rad soll nicht weggetragen werden können.
![]()
Gelegenheitsdiebe sind mit einem ordentlichen Schloss überfordert -- und Spezialisten nehmen das Rad oft versperrt mit. Deshalb habe ich mir eine einfachere Lösung erarbeitet. Zum Abschließen verwende ich ein Rahmenschloss und zum Anschließen ein Kabel mit zwei Ösen
==> t4. Schloss.
In der Praxis ist die Frage meist bedeutungslos, denn Alu- und Stahlräder sind fast gleich schwer. Die Unterschiede liegen eher bei Nebeneffekten:
-- Ein Alurahmen hat größere Rohre (da Alu mehr Querschnitt braucht), dafür ist er steifer. Bei einem Riss bricht das Rohr schlagartig. Eine Federung verhindert allzu starke Schläge auf den Rahmen; sie ist auch deshalb zu empfehlen.
Bei Rädern mit Federung, insbes. bei MTBs, wird der Alurahmen bevorzugt, da er wegen seiner höheren Steifigkeit nicht so schnell zum Schlingern neigt.
-- Ein Stahlrahmen hat kleinere und dünnere Rohre, er ist deshalb elastischer. Bei Anrissen dauert es bis zum Bruch einige Zeit, so dass die Chance besteht, den Riss vor einem Bruch zu entdecken. Bei Reisen in Entwicklungsländer findet man im Fall des Falles eher einen Stahlschweißer, als einen Aluschweißer. Außerdem kann man Stahl hartlöten, was ein einfacheres Reparieren ermöglicht.
k4.8. Federung
Wer nur auf Asfalt oder schönen Sandstraßen fährt braucht keine Federung! Sinnvoll ist sie aber für Reiseradler, die auch Schlaglochstrecken, Waldpfade (mit Wurzeln) oder Überraschungswege (gerne in der Stadt: Rinnen, Schwellen, Schienen, Kanaldeckel, Frostwellen auf Radwegen, ...) fahren. Beim MTB ist sie wohl Pflicht. k4.9. Schaltung
Man teilt sie, entsprechend den Benutzergruppen, am besten nach dem benötigten Schaltumfang ein. |
Jedwede Haftung ist ausgeschlossen, auch für Querverweise / Links.
Preise dienen zur groben, unverbindlichen Orientierung. Irrtum vorbehalten!
© Das Copyright liegt beim Verfasser.
![]()
Kontakt:
Radtipps
![]()
Letzte Änderung: 06.01.15
 |
|
 |
|